Anders?!
Wie meine vermeintlich kleinen Augen und mein schwarzes Haar ein ständiger Taschenspiegel des Andersseins sind
Ein monologischer Essay von Mai Saito aus dem Jahr 2019
Anmerkung vorab:
Dies ist ein Text, den ich für einen kleinen lokalen Schreibwettbewerb geschrieben hatte. Das Thema war „Anders?!“. Dies war Anfang 2019.
Mittlerweile, über drei Jahre später, weiß ich, dass ich damals das Thema „Othering“ aufgriff. Also die Tatsache, aufgrund eines vermeintlichen Andersseins ausgegrenzt zu werden und zu spüren: „Du bist anders“ – auch wenn das vielleicht gar nicht so stimmt. Damals hatte ich noch nie von dem Wort Othering gehört. Praktisch gesehen habe ich das aber immer wieder im Leben erfahren.
Einige wenige Stellen im Text habe ich redigiert, damit der Text triggerfreier ist. Der Sinn von vor drei Jahren bleibt dadurch immer noch erhalten. Meine Haltung hat sich sicherlich verändert, an einigen Stellen würde ich heute entschiedener sein oder dies konkreter als Rassismus bezeichnen. Seht den Text also eher als ein Fenster in meine damalige Zeit, in eine Zeit, in der ich mich noch nicht so intensiv mit Rassismus befasste, auch wenn es mich immer wieder begleitete – wie so viele in der Gesellschaft leider auch.
Triggerwarnung: Rassismus
Woher kommst du? – aus Baden-Württemberg. Wenn das die endgültige Antwort auf jene Frage wäre, würde ich bei manchen immer noch in Gesichter der Ungewissheit blicken: Für viele wäre die eigentliche Frage nicht geklärt. Auch wenn das Gegenüber versucht, die eigentliche Frage in Floskeln und Schönrednereien zu verstecken: Die Frage möchte eigentlich wissen, wo meine „Wurzeln“ liegen, aus welchem Land meine scheinbar kleinen, dunklen Augen und das tiefschwarze Haar stammen.
Früher jagte ich meistens ein „Meine Eltern kommen aus Japan“ hinterher; dann ersparte ich mir die peinlichen Blicke. Und wenn erst der heilige Gral gefunden wurde, kommt mir erneut ein kleines Lächeln entgegen – „So so, schön!“.
Anders sein ist vielseitig, für meine Mitmenschen oftmals interessanter als für mich. Worauf mein Aussehen und mein Name zurückzuführen sind, scheint für einige meiner Mitmenschen eine Schatzkammer der Informationen zu sein.
Wenn das nur das einzige wäre, womit mir gezeigt wird, dass ich anders bin.
In den Tagen, als ich als fünfjähriges Kind durch meinen Kindergarten tobte und meine ersten Kritzeleien anfertigte, waren es Tage und Jahre der kindlichen Gleichgültigkeit: Ob asiatisch, japanisch oder aus dem kleinen Dorf im Ländle – das war irrelevant. Wer geht mit mir Trampolinhüpfen? Wer möchte mit mir in den heiß begehrten Diskoraum? Wer möchte mit mir Fangen spielen? – Das waren die eigentlich relevanten Fragen.
Nach und nach begann die Zeit, in der sich der Taschenspiegel des vermeintlichen Andersseins entpuppte. Immer häufiger wurde mir gesagt: Du bist anders. – Aber bin ich wirklich so anders?
Das Schulleben näherte sich und meine Deutschkenntnisse glichen einer Tabula Rasa. Was tun? – Lernen. Dementsprechend war mein Tagesablauf bereits im späten Kindergartenalltag von Belohnungsstickern und Würfelspielen gezeichnet.
Jahre des Deutschlernens vergingen und ich erreichte das Stadium, in dem ich „Oh, du sprichst aber gut Deutsch“ oder „dein Deutsch ist ja völlig akzentfrei“ zu hören bekam. Einerseits sind es Momente, in denen ich denke: „Dankeschön, schön, dass sich die Stunden und Jahre des Deutschlernens auszahlen.“ Andererseits, so stur ich auch sein mag – irgendwann habe sogar ich die deutsche Sprache größtenteils verstanden. Schließlich war das Deutsche meine Lebenssphäre außerhalb meiner vier Wände: sei es im Klassenzimmer oder beim Herumtoben mit den Freund:innen. Deshalb ist für mich das „Lob“, dass mein Deutsch so gut ist, nicht selten befremdlich, vielleicht sogar ausgrenzend. Ebenso könnte ich die Gegenfrage stellen: Wieso sollte mein Deutsch nicht gut sein?
Aber: Das Äußere ist da, es ist unmittelbar und unausweichlich. Das Aussehen befindet sich auf einem Serviertablett, das dich und mich, Sie und uns zur Schau stellt, wo immer wir sind und wann immer wir existieren.
Das kann lästig sein: Wenn in der Stuttgarter Innenstadt die Zeugen Jehovas oder die Tierschutzorganisation Peta ihre Flyer verteilen, sprechen sie die Person links von mir an, die Person fünf Meter vor mir und auch zehn Meter hinter mir. Und mich? Nicht.
Unbekannte Leute anzusprechen, ist für solche Personen vielleicht nicht die Lieblingsbeschäftigung, wenn sie wissen, dass sie selbst durch die Stuttgarter Innenstadt bummeln könnten. Da liegt es nahe, dass man sich das Leben so einfach wie möglich macht und jene Menschen anspricht, die vermeintlich Deutsch sprechen können. Risikoavers sein ist einfach. Aber vielleicht auch zu einfach?
Für die einen ist es eine Erleichterung, wenn sie auf den Straßen Stuttgarts nicht aufgehalten werden. Für mich ist es wieder einmal der unsichtbare Spiegel, der zum Vorschein kommt: Nicht in allen, aber in vielen Fällen werde ich nicht angesprochen. Der kurze Moment des Interesses ist da, in anderen Momenten der einfache Wunsch, angesprochen zu werden, womit mir gezeigt werden würde: Ich denke, ich kann mit dir kommunizieren, du gehörst hierher.
Manchmal werde ich auf den Straßen nicht auf Deutsch angesprochen. Es sind Worte wie „Ching, chang, chong“, die mir mit einem breiten Grinsen entgegengeschleudert werden. Auch in jenen Momenten merke ich, dass der Spiegel des Andersseins da ist. Aber: Der Spiegel ist kaputt. Wörter, die das „Chinesische“ (Mandarin oder kantonesisch oder doch einer der Dialekte?) nachäffen, spiegeln nicht meine Identität wider.
All jene Momente sind Momente, die nervig sind. Momente, in denen ich denke: Diese Frage wäre wirklich nicht nötig gewesen. Und Momente, in denen ich denke: „Sprich doch mit mir, ich spreche doch Deutsch!“ oder „Gehöre ich etwa nicht hierher?“.
„So einfach wie möglich, aber nicht einfacher“ sind die Worte Einsteins. Aber der Scheideweg zwischen „so einfach wie möglich“ und „aber nicht einfacher“ ist nicht einfach: Niemand kann es jedem recht machen. Jede Person denkt und handelt anders; somit ist die Wahrnehmung subjektiv und die Beurteilung individuell.
Fast jede vierte Person[1] hat eine Kategorie, die für das Anderssein besonders attraktiv erscheint: Nationalitäten als Kategorisierungen scheinen einfach, bedient zu werden. Aber ich will nicht nur „die mit Migrationshintergrund“ sein.
[1] https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Migration-Integration/_inhalt.html (30.04.19)
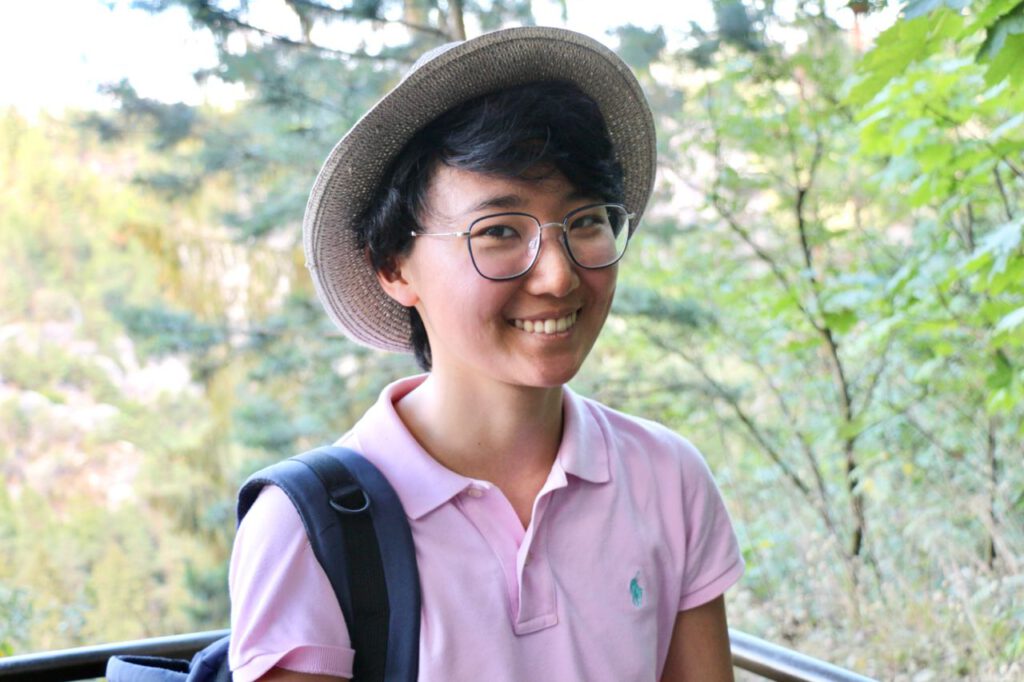
Mai (sie/ihr) studiert Mathematik, Philosophie und Alte
Geschichte an der Universität Heidelberg. Bevor es sie nach
Heidelberg verschlug, verbrachte sie ihre Kindheit und Jugend
im Dörfle mitten im Schwabenland – einer Gegend, die sie als
behütet und gemütlich empfand, die sie aber nicht vor
Rassismus schützte. Mittlerweile ist sie dabei, Rassismus besser
zu verstehen und ihre früheren Erfahrungen zu reflektieren und
zu verarbeiten, weil sie solche negativen Erfahrungen zuvor
eher “verschluckte”. Wenn sie nicht studiert, kocht und isst sie
sehr gerne und versucht sich an journalistischen Projekten.




